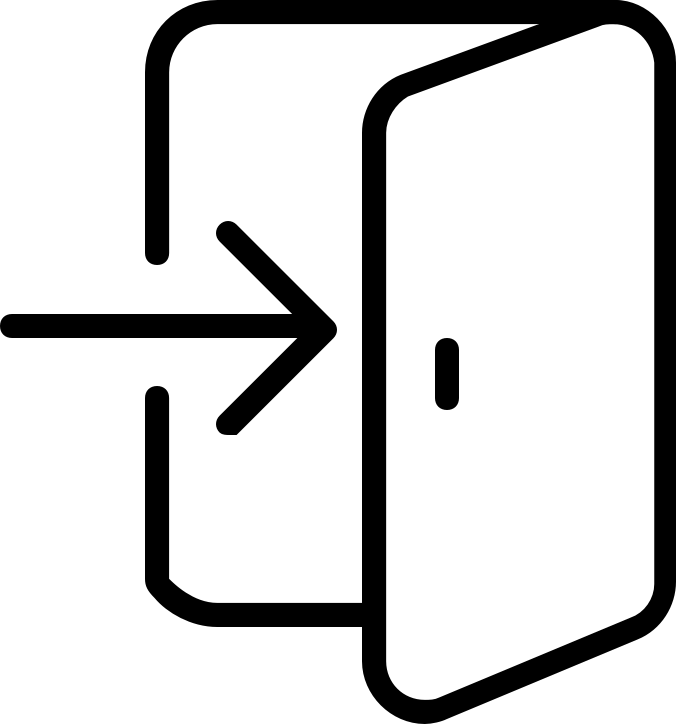- +49 2173 2640 310
- info@prisma.ag
Moment mal: die Agenda 2030? Leider ist wohl nicht die gleichnamige Agenda der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen gemeint, sondern wahrscheinlich das Wahlprogramm einer konservativen Partei mit einem „C“ im Namen.
Das Zitat von Kaeser greift jedoch zu kurz und widerspricht modernen Ansätzen der Nachhaltigkeitswissenschaft, wie dem 3-Nested-Dependencies-Modell, dem Konzept der planetaren Grenzen, sowie der Donut-Ökonomie.
Das 3-Nested-Dependencies-Modell von Willard stellt die Beziehungen zwischen Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft dar. In diesem Modell ist die Ökonomie in die Gesellschaft eingebettet, welche wiederum von der Ökosphäre abhängt. Dieses Modell verdeutlicht, dass die Wirtschaft keineswegs das zentrale Element ist, sondern lediglich innerhalb der gesellschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen funktioniert.
Ohne eine intakte Umwelt und stabile gesellschaftliche Strukturen kann die Wirtschaft langfristig nicht bestehen. Kaesers Aussage verkennt diese fundamentale Abhängigkeit. Wenn beispielsweise durch Umweltzerstörung oder soziale Instabilität wirtschaftliche Prozesse beeinträchtigt werden, kann die Wirtschaft ihre vermeintlich zentrale Rolle nicht mehr erfüllen.
Eine nachhaltige gesellschaftspolitische Ordnung muss daher die Ökologie ins Zentrum stellen und die Wirtschaft als Werkzeug für das Erreichen gesellschaftlicher und ökologischer Ziele betrachten. Der weltweit größte Rückversicherer SwissRE zeigt in seinem Dashboard „Economics of Climate Change“ sehr eindringlich, was es für unsere Wirtschaft bedeutet, wenn wir beispielsweise den Klimaschutz hintenanstellen: Bei einem Klimapfad von 3,2 Grad Erwärmung bis 2050 gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, wird allein in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) immer größere Verluste aufweisen. Die Verluste steigen von Jahr zu Jahr – ab 2048 liegen sie dann bei minus 11,1 Prozent jährlich.
Zudem erfolgt die Erhitzung in unseren Breiten fast doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Laut einer BMWK-Untersuchung werden wir bis 2050 für Klimafolgekosten staatliche Mittel von bis zu 900 Milliarden Euro verschlingen – was bleibt da noch übrig für Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Innovationen? Dabei haben wir hier die Schäden des Biodiversitätsverlustes, der drohenden Wasserknappheit und der PFAS-Verunreinigungen noch gar nicht berücksichtigt. Höchste Zeit also, um endlich effektiv gegenzusteuern und die Wirtschaft auf diese Entwicklungen vorzubereiten.
Das Konzept der planetaren Grenzen von Rockström et al. definiert neun biophysikalische Grenzen, innerhalb derer die Menschheit sicher agieren kann.
Bereits heute sind mehrere dieser Grenzen, wie der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität, überschritten. Dies bedroht die Stabilität des ökologischen Systems und damit auch die wirtschaftlichen Grundlagen.
Wissenschaftler warnen vor den Folgen der Grenzüberschreitung und verweisen auf kritische Schwellenwerte, die unumkehrbare Kippdynamiken auslösen können.
Der Fokus auf die Wirtschaft ignoriert die Tatsache, dass ökologische Grenzen die Grundlage für jede wirtschaftliche Aktivität bilden.
Ein Wirtschaftssystem, das die planetaren Grenzen missachtet, führt zwangsläufig zu Umweltkatastrophen und gesellschaftlichen Krisen.
Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik muss daher die Einhaltung dieser Grenzen in den Vordergrund stellen und die Wirtschaft entsprechend anpassen.
Kate Raworth‘s Konzept der Donut-Ökonomie bietet ein Modell für eine nachhaltige Wirtschaft. Der innere Ring des Donuts definiert das soziale Fundament, das sicherstellen soll, dass alle Menschen Zugang zu grundlegenden Ressourcen wie Nahrung, Bildung und Gesundheit haben. Der äußere Ring markiert die planetaren Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Eine Wirtschaft, die innerhalb dieses Donuts agiert, trägt sowohl zur sozialen Gerechtigkeit als auch zum Umweltschutz bei. Die Behauptung, dass soziale und ökologische Verantwortung nur aus wirtschaftlichem Erfolg erwachsen könne, verkennt die Möglichkeit und Notwendigkeit, die Wirtschaft so zu gestalten, dass sie von vornherein sozialen und ökologischen Anforderungen gerecht wird. Das Konzept der Donut-Ökonomie findet zunehmend Anhänger. In sogenannten Doughnut Economics Action Labs (DEAL) werden zahlreiche Informationsmaterialien und Hilfsmittel für die Umsetzung bereitgestellt.
Eine regenerative Wirtschaftsweise basiert auf einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, die Bedarfe reduziert, Ressourcen durch Wiederverwendung länger nutzt und Abfälle minimiert und damit am Ende mehr gibt als sie der Natur entnimmt, um Ökosysteme wiederherzustellen. Insbesondere die Prinzipien der Suffizienz spielen dabei eine entscheidende Rolle und werden derzeit kaum angewandt. Im Gegensatz zu einer konsumorientierten Wirtschaft, die auf ständiges Wachstum setzt, fordert Suffizienz ein Maßhalten im Ressourcenverbrauch. Das Ziel ist es, mit weniger materiellen Ressourcen ein gutes Leben zu führen und nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster zu etablieren.
Aktuell fokussiert sich bei der Nachhaltigkeitsdebatte unsere Wirtschaftsweise vornehmlich auf Effizienz- und Konsistenzstrategien, während Suffizienz als weniger erstrebenswert betrachtet wird, obgleich sich hier zahlreiche Chancen für neue Geschäftsmodelle ergeben:
• Effizienz: Besser produzieren – also das Gleiche, aber mit weniger Ressourcen und weniger CO2-Ausstoß.
• Konsistenz: Anders produzieren – einen Kreislauf von Produktion und Konsum herstellen. Nichts ist Müll, alles wird wiederverwertet. Wie in der Natur.
• Suffizienz: Weniger produzieren & konsumieren – mehr nutzenstatt besitzen, Genügsamkeit üben und sich von Wohlstandsmüll befreien.
Wer die Wirtschaft stärken und fit für die zukünftigen Herausforderung machen möchte, sollte Umweltschutz und Menschenrechten deutlich mehr Priorität einräumen, insbesondere im politischen Geschehen. Gegner argumentieren stets mit dem „Bürokratiemonster“ welches beispielsweise durch den EU Green Deal geschaffen worden sein soll, um die EU zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Dabei geraten auch die Europäische Berichterstattungspflicht (CSRD), die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) und natürlich das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG) und weitere Regulierungen der letzten Jahre in die Schusslinie.
Dabei sind solche Vorgaben genau das, was die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen seit 2011 im Rahmen der Schutzpflicht von Staaten verlangen: Damit Unternehmen diese Leitprinzipien einer nachhaltigen Wirtschaftsweise einhalten und die Schwächsten dieser Welt geschützt werden und ein Recht auf Abhilfe erhalten.
Das unsägliche „Omnibusverfahren“, welches nun im Februar in der EU diskutiert wird, erweist der Wirtschaft eher einen Bärendienst. Statt eben die Unternehmen zu belohnen, die sich konsequent einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise zugewandt und die EU-Vorgaben bereits umgesetzt haben, klatschen nun die Unternehmen Beifall, die noch untätig waren. Damit wird maximale Verunsicherung geschaffen – die Planungssicherheit für die Wirtschaft wird maximal geschädigt und damit die dringend notwendige sozial-ökologische Transformation. Die ohnehin knappen öffentlichen Mittel sollten die hart erkämpften bisherigen Errungenschaften schützen und stärken, statt erneut endlose Debatten zu alten Geschäfts- modellen wiederzubeleben, die uns in die Krise geführt haben.
The post Die Wirtschaft zuerst? appeared first on wll.news – der hub für working, learning & living.